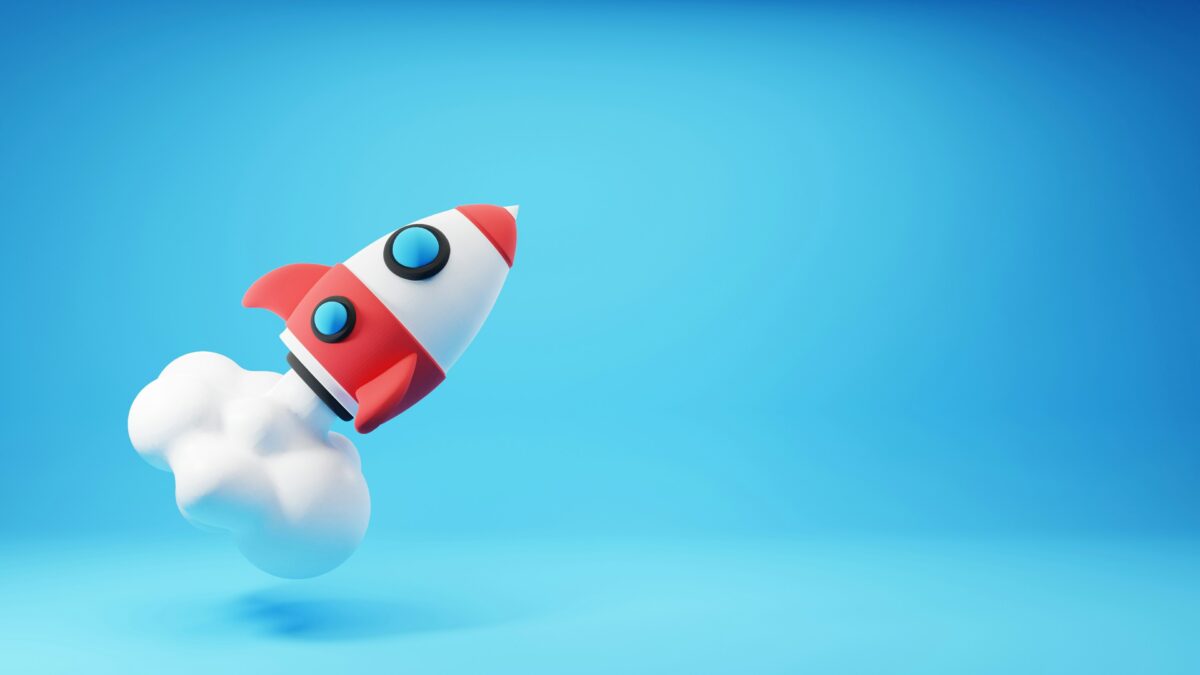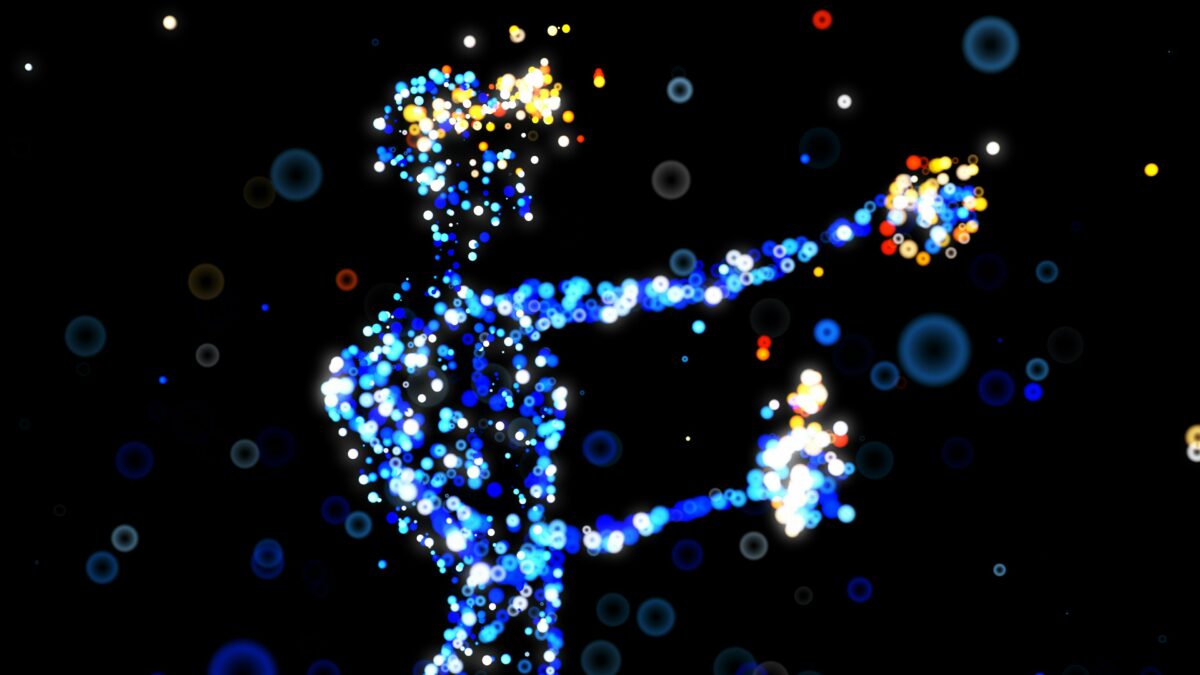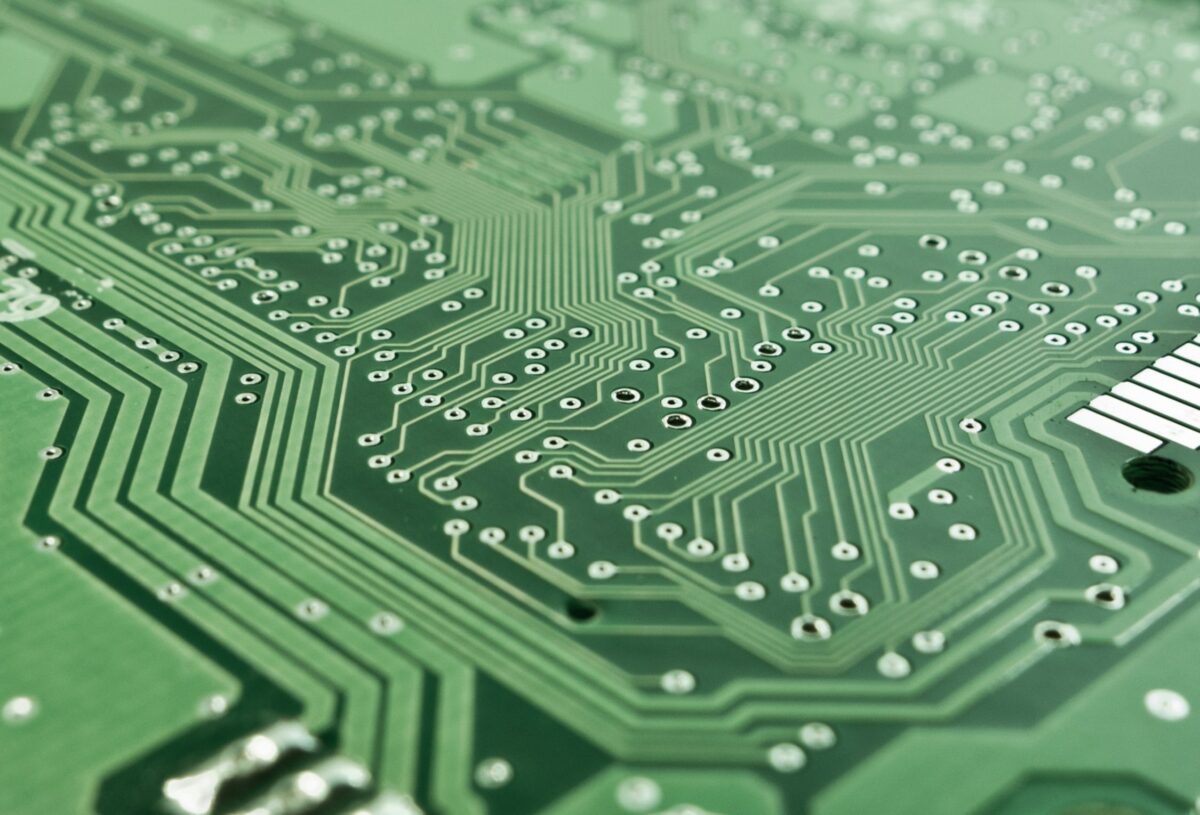Die Raumfahrt steckt mitten in einem rasanten Wandel. Bei Oikoplus begleiten wir diesen Wandel. Und in Reading List #041 empfehlen wir Good Reads darüber, was sich im All gerade so abspielt.
Mit gleich zwei der EU-geförderten Projekte, an denen wir bei Oikoplus beteiligt sind, legt Europa wichtige Grundsteine für zukünftige Space Ecosystems: In unserem Projekt Domino-E geht es darum, europäische Earth Observation (EO) Satelliten möglich effizient zu nutzen, um Satellitenbilder der Erde möglichst schnell und preiswert bereitstellen zu können. Und in unserem Projekt EU-RISE geht es darum, In-space Servicing, Assembly and Manufacturing (ISAM) Technologien voranzubringen.
Das ,Space Age’ hat unsere kollektive und (pop)kulturelle Vorstellung von Raumfahrt stark geprägt. Wie es dazu kam, lässt sich z.B. im Far Out Magazine nachlesen. Sprichwörtlich vergleicht man große (multi)nationale Wissenschafts- und Technologieprojekte bis heute mit dem Mondlandungs-Programm der NASA.
Das Apollo-Programm, das zwischen 1961 und 1972 zum Mond führte, ist nur eines der Beispiele für die Raumfahrt vergangener Tage. Von dieser Raumfahrt großer Programme und Missionen entwickelt sich die Raumfahrt hin zu modularen Systemen. Future Space Ecosystems werden bestimmt von vielen Akteuren jeder Größe und kommerziellen Anbietern für unterschiedliche Aufgaben von der Logistik, über die Kommunikation bis hin zur Entwicklung spezifischer Sensoren, Versuchsaufbauten und Spezialtechnologien, die im All angewendet werden. Wie dieser Wandel aus europäischer Perspektive ablaufen soll, das steht beispielsweise in der Technology Strategy der Europäischen Weltraumagentur (ESA). Große Systemintegratoren wie der Airbus-Konzern, spielen darin nur eine Rolle von vielen – wenn auch eine wichtige.
Eine neue Phase der Earth Observation
In den vergangenen Jahren ist eine Vielzahl neuer Geschäftsmodelle in der Raumfahrt entstanden. Projekte, die im Wesentlichen auf privaten Investitionen beruhen, werden oft als „New Space” bezeichnet. Unternehmen wie SpaceX, die z.B. vergleichsweise preiswerte Transportmöglichkeiten in Umlaufbahnen anbieten, setzen etablierte Akteure unter Druck. Hinzu kommen die nationalen Raumfahrtprogramme aufstrebender Nationen, die der Branche ebenfalls frischen Wind einhauchen. Auf diese Entwicklung reagiert Europa, und die Position Europas in der Raumfahrt zu behaupten, ist ein Anliegen, das die EU durch Horizon Europe Projekte wie Domino-E und EU-RISE unterstützt.
Für das Gebiet der Earth Observation hat die ESA sechs Trends gelistet, von denen der Umbruch, der in vollem Gange ist, geprägt wird. In den vergangenen dreißig Jahren, konnte Europa sich im internationalen EO-Wettbewerb gut behaupten. 1972 wurde der erste nicht-militärische amerikanische Erdbeobachtungs-Satellit namens Landsat1 in den Orbit geschickt. 1986 folgte mit dem französischen SPOT1 der erste europäische kommerzielle Beobachtungssatellit. Seither hat sich der europäische Systemintegrator Airbus hinter Maxar (USA) als zweitstärkster Anbieter auf diesem Markt behauptet. Das Domino-E Projekt, an dem Oikoplus als Teil eines multinationalen Konsortiums unter Leitung von Airbus mitwirkt, trägt zur Anpassung der europäischen EO-Technologien an das New Space Age bei, indem es die Wettbewerbsfähigkeit der in Europa betriebenen Systeme erhöht, also effizienter, zugänglicher und schneller macht. Nähere Informationen zum Projekt finden sich auf www.domino-e.eu.
Modulare Open-Source-Roboter: Die Werkstatt im Weltraum
Ein anderer Raumfahrt-Bereich, der in einer Phase grundlegender ökonomischer und technologischer Innovationen steckt, ist der Bereich des robotischen In-space Servicing, Assembly and Manufacturing (ISAM) Dabei geht es um das Durchführen mechanischer Arbeiten an Satelliten direkt auf der Umlaufbahn – on-orbit. In den letzten Jahren wurden auf diesem Feld zahlreiche Projekte, Technologien und einzelne Module entwickelt. Denn mechanische Arbeiten im Weltraum von Robotern durchführen lassen zu können, ist eine Schlüsseltechnologie der Raumfahrt der Zukunft. Schließlich werden zahlreiche Satelliten im Betrieb günstiger und nachhaltiger, wenn sie repariert und erweitert werden können – statt sie durch neue zu ersetzen.
Das Projekt EU-RISE, an dem Oikoplus beteiligt ist, leistet hier einen wichtigen Beitrag, indem es künftige Geschäftsmodelle für den Betrieb von ISAM-Dienstleistungen analysiert, und indem es bereits entwickelte europäische Komponenten von ISAM-Systemen miteinander verknüpft und in einem End-to-End Demonstrator testet. Die Open-Source-Strategie, die EU-RISE dabei verfolgt, soll dazu führen, dass standardisierte Schnittstellen und Systeme entstehen, die es möglichst vielen Akteuren unterschiedlicher Größe erlauben, zu Europas ISAM-Technologie beizutragen.
Europa ist natürlich nicht die einzige Weltregion, und die Europäische Union nicht der einzige staatliche Akteur, der hier seine Marktanteile sichern möchte. Auch in den USA werden groß angelegte ISAM-Strategien verfolgt. Die NASA bietet in ihrem ISAM State of Play einen guten Überblick, welche Technologien hier die Raumfahrt der Zukunft prägen könnten.
Bei Oikoplus sind wir froh (und auch ein wenig stolz), einen Beitrag zur europäischen Raumfahrt leisten zu können, indem wir die Konsortien unserer Raumfahrtprojekte in ihrer Kommunikation und Dissemination unterstützen. Denn Raumfahrt liefert einen enormen Beitrag zu den Möglichkeiten, die sich uns allen im Alltag bieten, für Forschung in unterschiedlichsten Bereichen, und beim Verständnis unseres Universums. Wer sich einen Überblick darüber verschaffen möchte, in welchen Bereichen Europas Raumfahrt eine wichtige Rolle spielt, kann das bei der EUSPA, der European Union Agency for the Space Programme tun.
Als EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen 2019 den EU Green Deal verkündete, sprach sie von “Europe’s man on the moon moment”. Eine schöne Metapher. Und wie der EU Green Deal ist auch Europas Weg in die Zukunft der Raumfahrtindustrie eine große Aufgabe, an der viele im Kollektiv mitwirken. Wir auch.